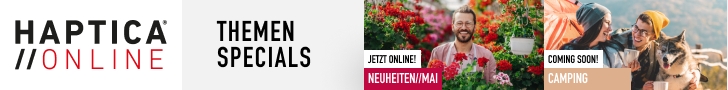Lange schienen Werbung und Vermarktung nicht so recht vereinbar mit der altehrwürdigen Institution Museum. Doch die Vorbehalte sind einer realistischen Einschätzung gewichen: Nicht zuletzt die Finanznot von Bund und Kommunen zwingt die Museen zu einer offensiveren Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit.
Wie man mit gegenständlicher Werbung Aufsehen erregen kann, zeigte Anfang August 2011 das Museum of Design in Atlanta (MODA). Im Juni wurde dort die Ausstellung „WaterDream: The Art of Bathroom Design“ eröffnet. Eine interessante Ausstellung mit Design-Marken wie Philippe Stark und Hans Grothe – in den lokalen Tageszeitungen wie dem Atlanta Constitution Journal durchaus wohlwollend besprochen, aber ohne großen Besucherandrang. Um das zu ändern, beschloss das MODA eine „Invasion der Quietsche-Entchen“, wie die Aktion bald darauf in den Blogs genannt wurde. Auf prominenten Plätzen in der Innenstadt von Atlanta wurden gelbe und rote Gummi-Enten in großer Zahl ausgesetzt. Mitnehmen konnte sie jeder, aber auf einem Zettel an der Unterseite wurden die neuen Besitzer gebeten, die Ente beim Badewannen-Einsatz zu fotografieren und das Foto dann auf die Facebook-Seite des Museums zu posten. Eine Mo’duck, wie die Ente im Werbeeinsatz für das MODA phonetisch passend genannt wurde, schaffte es sogar in die Karibik: Ein Paar ließ sich beim Tauchgang vor den Kaiman-Inseln mit Quietsche-Ente ablichten; ein anderer beteiligte sein Exemplar an der Autowäsche. Die Rechnung dieses Guerilla-Marketings ging auf: Lokale TV-Sender und Blogs berichteten über die Aktion und die Ausstellung wurde mit einem Schlag bekannt. „Rund 400 bis 500 zusätzliche Besucher hat der Einsatz der Enten gebracht“, schätzt Laura Flusche, Associate Director des Museums.
Einnahmequelle und Werbeträger
Im Gegensatz zu den USA, wo die wenigsten Museen sich auf staatliche Subventionen verlassen können, wurde in Deutschland lange Zeit Merchandising als problematische Kommerzialisierung von Kunst geringgeschätzt. Doch die Finanznot von Bund und Kommunen zwingt inzwischen zum Umdenken. Als in Berlin 2004 Werke des New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) gezeigt werden sollten, wuchsen die Kosten für die Ausstellung auf über 12 Mio. Euro an. Mit staatlicher Unterstützung allein ließ sich das nicht mehr realisieren, und so wurde eine groß angelegte Marketing-Kampagne gestartet.
Um nicht in die roten Zahlen zu rutschen, mussten mindestens 700.000 Menschen die Ausstellung besuchen. Man war also auf überregionale Attraktivität und die Ansprache von Bevölkerungsschichten angewiesen, die nicht dem klassischen Typus des Museumsbesuchers entsprachen. Schon im Vorfeld wurde die MoMA in Berlin als eine eigenständige Marke aufgebaut, und es gelang, einen regelrechten Hype zu schaffen.
Ein wichtiger Faktor in den Refinanzierungsplänen war das Merchandising. Im Museumsshop wurde so ziemlich alles von Mousepads, Tassen über Socken hin zu Regenschirmen und T-Shirts angeboten. Die Merchandising-Artikel dienten nicht nur als Einnahmequelle, sondern auch als Werbeträger, als Mittel, das kulturelle Großereignis ins Stadtbild zu tragen und den Sog des „Da muss man gewesen sein“ zu verstärken. Der Shop wurde nicht verschämt in eine Art Hinterzimmer verbannt, sondern offensiv auf großer Fläche präsentiert. Und man verschmähte auch nicht die ungeniert verkaufsfördernde Maßnahme, gelegentlich die an der Kasse wartenden Besuchermassen in den Merchandising-Shop umzuleiten.
Diese an amerikanischen Vorbildern geschulte Kunstvermarktung rief zwar einige Kritik in den Feuilletons hervor, aber die Ausstellungsmacher konnten mit dem finanziellen Erfolg zufrieden. Von den 1,2 Mio. Besuchern kaufte durchschnittlich fast jeder in Höhe des Eintrittsgeldes im Merchandising-Shop ein, der so ca. 1 Mio. Euro als Gewinn verbuchen konnte.
Breitenwirkung
Merchandising ist für Museen inzwischen unverzichtbar geworden, aber mit ihm ist auch eine gefährliche Nähe von Kunst und Kitsch entstanden und der Versuch der Popularisierung gleitet manchmal in die Banalisierung ab. Wie man solche Gefahren vermeiden und dennoch breitere Bevölkerungsschichten für etwas begeistern kann, das eher der Aufmerksamkeit einer kleinen Minderheit vorbehalten scheint, zeigt die Ausstellung „Die Geretteten Götter aus dem Palast vom Tell Halaf“, die das Pergamonmuseum in Berlin von Januar bis August dieses Jahres präsentierte und die mit ca. 780.000 Besuchern zu einem außerordentlichen Erfolg wurde. Zu sehen waren 3.000 Jahre alte Statuen, und das ist für die meisten eine zunächst wenig aufregende Angelegenheit. Doch die Ausstellungsmacher wussten konsequent das Spannungspotenzial ihrer Geschichte zu nutzen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war der deutsche Archäologe Max v. Oppenheim bei Ausgrabungen im heutigen Syrien auf die sensationellen Überreste eines Fürstenpalastes gestoßen. Götterbilder und Grabbeigaben, die ihm nach dem Reglement der Behörden zustanden, ließ er nach Berlin transportieren und dort in einem eigenen Museum aufstellen. 1943 ging bei einem Bombenangriff das Museum in Flammen auf, und während die Exponate aus Kalkstein verbrannten, überstanden die Statuen aus Basalt zwar das Feuer, zerbarsten aber im Kontakt mit dem Löschwasser in abertausend Stücke.
Max v. Oppenheim ließ diese Fragmente seiner berühmten Sammlung ins Pergamon-Museum bringen – in der damals aberwitzig anmutenden Hoffnung, eines Tages seien seine Götter zu restaurieren. Und das, was dem Laien völlig aussichtslos erscheinen musste, gelang Archäologen und Restauratoren in neun Jahren aufwendigster Arbeit: 27.000 Einzelteile wurden einander zugeordnet und zusammengefügt.
An diese gigantische Puzzlearbeit knüpfte das Gewinnspiel an, mit dem die Ausstellung beworben wurde. Auf der Vorderseite der Teilnehmerkarte waren die fragmentierten Teile einer Götterstatue als Sticker aufgebracht, die innerhalb des Umrisses auf der Rückseite zusammengesetzt werden mussten. Für Facebook wurde mit der Figur des „Hans Huckebein“ ein persönlicher Ansprechpartner der Besucher kreiert: Die Vogelstatue, einst von Max v. Oppenheim nach dem Raben bei Wilhelm Busch benannt, avancierte zum Star.
„Von dem enormen Erfolg wurden wir überrascht“, sagt Elisabeth Rochau-Shalem, Referatsleiterin Publikationen und Merchandising der Staatlichen Museen zu Berlin. „Aber diese Resonanz zeigt uns, wie sehr sich viele Menschen eine solche Vermittlung, einen Moderator, mit dem sie sich identifizieren können, wünschen. Das werden wir bei kommenden Ausstellungen berücksichtigen.“ Und Corinna Salmen, Projektleiterin für die Kommunikation der Ausstellung, fügt hinzu: „Viele Besucher, z. B. aus dem süddeutschen Raum, fanden über die Hans-Huckebein-Seite zu uns. Wir wollten über Facebook nicht nur Menschen zu einem Ausstellungsbesuch motivieren, sondern sie auch danach – als Multiplikatoren im sozialen Netzwerk – an uns binden.“
Ausgestattet mit großer Klappe und viel Humor wurde Hans Huckebein für seine Fans zu einem Alltagsbegleiter, mit dem sich akademische Unnahbarkeit vermeiden ließ. „So konnten wir viel direkter mit unseren Besuchern kommunizieren und sicher auch Hemmungen abbauen“, meint Salmen.
Erinnerungsmarketing
Im historischen Bau des Pergamonmuseums ist nicht viel Platz für den Merchandising-Shop, aber um so mehr wurden die Artikel – teils vom Museum selbst in Auftrag gegeben, teils lizenziert – mit großer Behutsamkeit ausgewählt. Ein Puzzle, hochwertige Olivenseife mit eingestanztem Götterbild, Artikel, die Details zur Geltung bringen wie Seidentücher, die mit Gefäßdekoren bedruckt sind.
„Wir legen großen Wert darauf, dass die Würde und Integrität der Objekte gewahrt bleibt“, erläutert Elisabeth Rochau-Shalem die Vermarktungsprinzipien. „Leider sind wir in unserer Gestaltungsfreiheit durch Vergaberichtlinien eingeschränkt und können nicht immer sofort da investieren, wo es sich lohnen würde. Aber wir haben die Möglichkeiten erkannt, die uns Merchandising bietet. Natürlich freuen wir uns über den finanziellen Rückfluss, aber mindestens ebenso wichtig ist es uns, unseren Schätzen eine größere Wirkung in der Öffentlichkeit zu verschaffen.“
Eine besonders hochwertige Spielart des Merchandisings sind Replikate. Mit der 200 Jahre alten Gipsformerei, die den Staatlichen Museen Berlins angeschlossen ist, steht eine hervorragende Manufaktur zur Verfügung. So wurde eine Nachbildung der Nofretete geschaffen, die sich bis ins kleinste Detail am Original orientiert. Wesentlich preiswerter ist die Büste der Isabel y Aragón, die nur 180 Euro kostet. Geplant ist auch eine Echt-Schmuck-Edition, die bedeutenden Stücken aus Museumsbesitz nachgebildet ist. „Viele Leute möchten das, was sie im Museum nur auf Distanz betrachten können, als – allerdings wirklich gutgemachte – Replik mit nach Hause nehmen“, urteilt Rochau-Shalem über den Bedarf.
Auch in den unteren Preiskategorien ist „Qualität für uns eine unhintergehbare Voraussetzung“, so Rochau-Shalem. Hochwertige Süßigkeiten und Puzzles, mit denen sich die Auseinandersetzung mit den Kunstwerken spielerisch vertiefen lässt, gehören zum Programm. Bei bei einem Ischtar-Tor- Puzzle aus Steinen, in die archäologische Motive graviert sind, „wird der Bildwert durch die haptische Wahrnehmung besonders nachdrücklich ergänzt“, meint Rochau-Shalem. „Zum Erinnerungsmanagement gehört es sicher auch, nicht nur auf das Sichtbare zu setzen, sondern Menschen etwas buchstäblich in die Hand zu geben.“
//Irene Unglaube